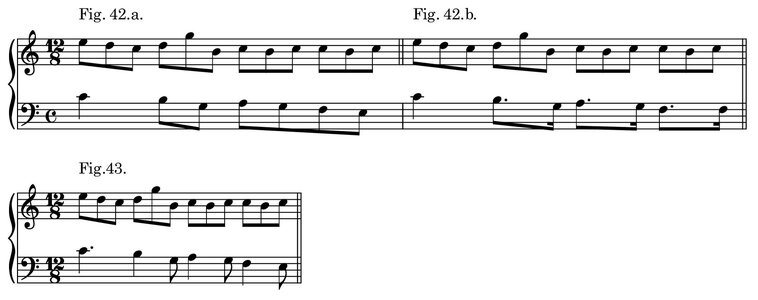- Registriert
- 17.10.2021
- Beiträge
- 3.859
- Reaktionen
- 2.643
Das kommt auf das Training der Ohren (und des Gehirns dazwischen) an, sowie auf die Geschwindigkeit, mit der gespielt wird. Außerdem ist relevant, worauf sich der Hörer konzentriert. Wie schon im vorigen Posting angedeutet: Wenn man sich auf Rhythmus 1 konzentriert, soll man etwas in sich Gleichmäßiges hören, bei Rhythmus 2 ebenso. Zusätzlich sollen die Punkte, an denen Schläge aus beiden zusammenfallen, exakt sein. Allein daraus ergibt sich, dass es im Idealfall exakt gespielt wird. Ist es nicht exakt zueinander, ist es vielleicht gleich gut, vielleicht schlechter, aber sicher nicht besser.